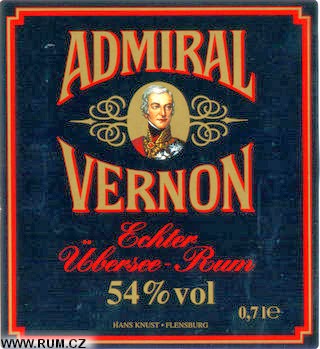Das gibt es nur in England, dass der oberste Repräsentant der oberen Kammer des Parlaments auf einem Wollsack sitzt. Und das schon seit dem 14. Jahrhundert. Es gibt da im Oberhaus auch noch einen Thron, aber auf dem darf der Lord Chancellor nicht sitzen, da sitzt nur die Königin zur Parlamentseröffnung. Der woolsack ist ursprünglich einmal wirklich ein Sack Wolle gewesen, der das Parlament immer daran erinnern sollte, dass England mit der Woche reich geworden ist. Im Mittelalter enthielt ein woolsack die Wolle von 220 Schafen. Jetzt sieht der woolsack aus wie ein Möbelstück aus den 70er Jahren, wir würden uns nicht wundern, wenn Austin Powers in einem Samtanzug und einem Rüschenhemd auf dem roten woolsack sitzen würde. Früher war da englische Wolle drin, jetzt ist es Wolle aus allen Teilen des Commonwealth. Auf dem roten Sofa liegt das mace als Zeichen der königlichen Autorität des Amtsinhabers. Ohne diesen symbolischen Stab kann das Oberhaus nicht tagen. Im Unterhaus ist das genau so, aber da liegt das mace auf einem Tisch, nicht auf dem woolsack.
1976 hat Michael Heseltine das mace ergriffen und damit herumgefuchtelt, als die walisischen Labour Abgeordneten The people's flag is deepest red gesungen haben. Daraufhin kriegte der Tony mit seinen wehenden langen blonden Haaren von der Presse den Namen Tarzan. Er hat sich natürlich am nächsten Tag beim speaker des Parlaments entschuldigt. In den Zeiten von Austin Powers geht es schon wild zu im englischen Unterhaus. Der Lord Chancellor bekommt über 200.000 Pfund im Jahr. Das ist mehr als jeder Minister, aber etwas weniger als das, was Wayne Rooney verdient. Dafür braucht der aber bei seiner Arbeit keinen Talar und keine Perücke zu tragen. Tony Blair hat bei seiner Parlamentsreform am Amte des Lord Chancellors herumgedoktert. Sein Lord Chancellor Lord Falconer war der erste, der keine Perücke mehr trug. Jetzt sitzt im Oberhaus der Lord Speaker auf dem roten Wollmöbel, und das ist im Zeichen der Emanzipation eine Frau. Aber die Baronin Hayman trägt jetzt wieder (wie man auf dem Photo oben sehen kann) eine Perücke.
Die Wolle hat England reich gemacht. Sie ist das goldene Vlies der Nation. Shakespeares Vater war im Wollhandel, wenn auch manchmal mit etwas illegalen Geschäften. Kleine Dörfer werden mit dem Wollhandel reich und bauen riesige Kirchen, die wool churches heißen (wool churches haben sogar einen Wikipedia Eintrag). Über die Jahrhunderte hat man die englische Landschaft den Schafen angepasst. Es hat einmal riesige Wälder in England gegeben, in denen sich Robin Hood mit seinen Gesellen vor dem Sheriff von Nottingham verstecken konnte. Aber die englischen Eichen hat man für die Flotte gebraucht, was John Keats in seinem Gedicht Robin Hood beklagt: He would swear, for all his oaks, Fall'n beneath the dockyard strokes, Have rotted on the briny seas. Kein Platz mehr für Robin und Marian, man braucht Platz für die Schafe. Und dafür vertreibt man dann auch die Menschen, wie bei den schottischen highland clearances. Und wenn das nicht ausreicht, dann nimmt man ganz Australien dazu.
Während des Zeiten Weltkrieges gab es in England 1942 ein Propagandaplakat von Frank Newbould. Über dem Slogan Your Britain: Fight for it Now zeigte es eine idyllische hügelige Landschaft. Und natürlich eine Herde von Schafen in der Bildmitte. The lowing herd winds slowly o'er the lea, der Idealtypus der englischen Landschaft. Schafe (aber auch Kühe und Schweine) sind schon lange vorher auf englischen Bildern zu finden.
➱Thomas Gainsborough malt 1752 die Witwe des Brauereibesitzers Thomas Cobbold mit ihrer Tochter in eleganten Kleidern in die englische Landschaft. Mit Schaf und einem Bähschäfchen in den Armen der Tochter. Aber auch reiche Farmer lassen sich die wolligen Tiere malen, die ihren Reichtum begründen. Im Jahr nach der verheerenden Maul- und Klauenseuche gibt es in Carlisle eine Kunstausstellung Love, Labour&Loss: 300 Years of British Livestock Farming in Art. So etwas kriegen nur die Engländer hin. Mit einem wunderschönen, reich bebilderten Katalog, zu dem der Prinz von Wales das Vorwort geschrieben hat.
Shakespeares Winter's Tale spielt in Böhmen (das bei Shakespeare am Meer liegt, Ingeborg Bachmann hat ein berühmtes Gedicht über Böhmen am Meer geschrieben), und in dem Stück, in dem alle Englisch sprechen, kommen auch Schäfer vor. Perdita wird von einem Schäfer als seine eigene Tochter erzogen. Normalerweise haben wir da keine Schafe auf der Bühne, aber als Peter Zadek (das schwarze Schaf der deutschen Regisseure) den Winter's Tale 1978 in Hamburg auf die Bühne brachte, gab es Schafe. Zadek hatte zuvor die Baronin ➱Dr. Gisela von Stoltzenberg in Trittau besucht, die eine wirkliche Shakespeare Spezialistin war und ihm gute Ratschläge für die Aufführung gab. Beim Abschied sah Zadek eine kleine Schafherde auf dem Gelände des Landhauses und fragte die Baronin, ob er einige Schafe für die Aufführung borgen könne. Er bekam die Schafe, die dann auf der Bühne in dem grünen Glibberschleim steckten, mit dem Zadek die Bühne bedeckt hatte. Die Schafe (die in jeder Rezension erwähnt wurden) und der grüne slime waren das einzig Denkwürdige an der Inszenierung. Die Baronin hat sich wochenlang Sorgen um die Schafe gemacht, sie haben aber die Aufführung wohlbehalten überstanden. Grüner slime, was für ein Unsinn.
William Blake, der das Gedicht Little lamb who made thee geschrieben hat, wäre entsetzt gewesen. Er hat auch ein Bild mit dem Titel Christ Child riding on a lamb gemalt. Da sitzt der Jesusknabe auf einem Schaf, und das steht auf grünem Gras. Schafe gehören auf grünes Gras, keinen grünen slime. Bevor das Schaf zum Lieferanten für Englands Reichtum wurde und bevor die Australier das Wollsiegel erfanden, ist das Schaf immer ein christliches Symbol gewesen. Und jetzt, wo es auf Ostern zugeht, und die die ersten Osterlämmer auf den Wiesen sind, ist es vielleicht auch angebracht, eine Bach Kantate zu zitieren:
Schafe können sicher weiden
wo ein guter Hirte wacht!
Wo Regenten wohl regieren
kann man Ruh' und Frieden spüren
und was Länder glücklich macht.