Es tut sich viel in der Mode in diesem Jahrhundert, sowohl in der Damen- wie der Herrenmode. Viele dieser Veränderungen gehen von England aus. Was auch daran liegt, dass sich die Engländer im 18. Jahrhundert ein Weltreich erobern, und die Industrial Revolution eine Erfindung der Engländer ist. Der erste Ballen Wolle aus Australien kommt zwar erst 1807, aber von da an sind auch Australien und Neuseeland aus der Welt der Wolle nicht mehr wegzudenken. Die Wolle ist seit Jahrhunderten wichtig für England, warum säße der englische Lord Chancellor sonst auf dem wool sack?
Auf diesem Bild aus dem 18. Jahrhundert sehen wir schottische Frauen beim Walken von Wolle; beinahe alles, was man bisher mit den Händen (oder Füßen) gemacht hat, wird im 18. Jahrhundert mechanisiert werden. Als die Römer nach England kamen, gab es da schon eine florierende Wollindustrie Die Römer schwärmten von englischen Wollstoffen, die so fein wie ein Spinnennetz seien. Der birrus Britannicus, ein kurzer Wollmantel, wird bei den Römern chic. Irgendwie scheinen die wolligen Rohstofflieferanten in England mit der Zeit überhand zu nehmen. Der Reverend Thomas Bastard beklagt 1598 (ironischerweise auf dem Höhepunkt der Schäferlyrik) in einem Epigramm:
Sheep have eat up our meadows and our downs,
Our corn, our wood, whole villages and towns:
Yea, they have eat up many wealthy men,
Besides widowes and orphane children;
Besides our statutes and our Iron Lawes,
Which they have swallowed down into their mawes :
Till now I thought the proverbe did but jest,
Which said a black sheep was a biting beast.
Die Wolle wird im 18. Jahrhundert bei den Röcken der Herren peu à peu die Seide verdrängen. Am Ende des Jahrhunderts wird George III auch bei offiziellen Empfängen broadcloth statt Samt oder Seide tragen. Und er hat nichts dagegen, wenn sein Premierminister Pitt im braunen Wollanzug in den Palast kommt. Als George Washington sein Amt als erster amerikanischer Präsident antritt, wird er einen Anzug aus amerikanischer Wolle tragen, keinen Rock aus Samt oder Seide. Sie könnten jetzt hier den langen Post George Washington (sartorial) lesen.
Der wichtigste Import aus dem immer größer werdenden Empire ist die Baumwolle aus Indien, die die heimischen Marktstrukturen verändert. Manchester wird zum wichtigsten industriellen Zentrum der Welt, die Baumwolle wird beinahe zu einer Religion. Auf jeden Fall in den Worten des alten Dubslav von Stechlin in Fontanes Roman: Sie sind drüben schrecklich runtergekommen, weil der Kult vor dem Goldenen Kalbe beständig wächst; lauter Jobber, und die vornehmen Leute obenan. Und dabei so heuchlerisch; sie sagen Christus und meinen Kattun. Fontane kannte das England, über das er schrieb. Ein Deutscher, der lange in Manchester gelebt hat, wird Die Lage der arbeitenden Klasse in England schreiben.
Aus Indien kommt nicht nur die Baumwolle, von dort kommt auch Kaschmir nach England. Zumeist in der Form von Shawls. Im schottischen Paisley (aber auch in Norwich, lesen Sie hier alles dazu) entsteht jetzt ein Zentrum für die Produktion von Cashmere Shawls. Die nicht aus Kaschmir, sondern aus Wolle sind, aber das typische Muster haben, das wir bis heute als Paisley kennen. Dieses Bild von John Singleton Copley zeigt die Gattin von General Gage (die hier schon einmal erwähnt wurde) mit einem hochmodischen Paisley Kopfschmuck. Der wahrscheinlich aus Indien und nicht aus Schottland stammt. Nach Meinung der englischen Professorin Eileen Ribeiro ist dies vielleicht ein Kopfschmuck aus der Türkei, der gerne bei Londoner Kostümfesten getragen wurde.
Die Herrenmode Englands findet in Europa Beachtung, weil die reisenden Engländer ihre Mode auch in andere Länder tragen. Die Engländer schauen allerdings schon darauf, was in Paris getragen wird, und Pariser Seidenwesten für den Herrn sind ein beliebter Schmuggelartikel der englischen Gentlemen. Dies Bild von Gainsborough zeigt natürlich keinen englischen Zollspürhund beim Erschnüffeln einer französischen Weste, es zeigt Lord George Vernon im dreiteiligen Anzug, dem Justacorps, den die englische Mode seit Charles II kennt.
Eigentlich brauchte man gar keine Westen aus Frankreich zu schmuggeln. Die Seidenweberei in Spitalsfield, die am Ende des 17. Jahrhunderts von französischen Hugenotten begründet wurde, hat im 18. Jahrhundert einen Höhepunkt. Und die Qualität der englischen Seide ist so gut, dass sie für die Italiener begehrenswert ist (die dann natürlich englische Seide schmuggeln). Seit den 1730er Jahren sind noch irische Leinenweber nach Spitalsfield gekommen, die den Hugenotten Konkurrenz machten. Die erwächst dem traditionellen Handwerk der Seidenweber auch durch die aus Indien importierten billigen Baumwollstoffe. Das Weltreich, das England sich jetzt erobert ist - wenn man so will - auch der Beginn der Globalisierung. Die Auseinandersetzungen zwischen Hugenotten und Iren werden zu erbitterten Arbeitskämpfen führen, deren Höhepunkt 1769 die Spitalfield Riots sind. Da hängt man einen Hugenotten und einen Iren auf, dann ist erst einmal Ruhe.
Der Engländer des 18. Jahrhunderts gibt sich auf dem Land ein wenig nachlässig, man passt sich dem Stil der gentry an. Zum einen ist es praktisch, zum anderen möchte man die modisch überdrehten französischen Froschfresser ja nicht imitieren. Das überlässt man anderen. Zum Beispiel der neuen, reich gewordenen bürgerlichen Schicht. Und natürlich dem schönen Geschlecht. Im Jahre 1730 notiert ein portugiesischer Kaufmann namens Don Manuel Gonzales über die Kleidung der englischen Herren: for raiment, the common wear amongst the men is plain cloth and drugget, without any thing of costly ornament. Und César de Saussure schreibt in seinen Letters from London (als Briefe über London 1792 in Hamburg erschienen), dass die englischen Gentlemen keinen Goldschmuck (und keine Zierdegen) trügen. Das auf dem Bild ist übrigens der siebte Lord Vernon, im Jahre 1854 von dem Amerikaner Julian Russell Story gemalt. Ähnlichkeiten in der Kleidung der beiden Lords sind nicht rein zufällig.
Auf dem Land kann man den englischen Gentleman kaum von seinen Gutsverwalter und Wildhütern unterscheiden. Der frock, den die gentry ab 1730 von den Landbewohnern übernimmt (und der sich von dem damals vorherrschen Anzug dadurch unterscheidet, dass er einen Kragen und ein Revers hat) wird kürzer. Die lange Weste wird verdrängt durch den kürzeren gemusterten Newmarket waistcoat. Die karierten Tattersall Westen, die man in englischen Filmen sehen kann, sind die modernen Vertreter dieser Weste. Auf dem Bild Thomas Nuthall with a Dog and Gun von Sir Nathaniel Dance-Holland (oben) sehen wir einen upper class Gentleman bei der liebsten Freizeitbeschäftigung der Engländer. Seine Kleidung ist ziemlich unspektakulär und sicher praktisch. Zwischen dem Bild Sir Nathaniel Dance-Hollands und diesem Werbephoto liegen Jahrhunderte, aber der Stil bleibt der gleiche.
Der country gentleman wird zu einem modischen Ideal des 18. Jahrhunderts. Und das ist er vielleicht noch heute. Die weltweit verkaufte Englishness ist ja weniger die Kleidung der Londoner City als ein tradiertes Ideal, das aus dem Moderepertoire der TV Verfilmung von James Herriots All Creatures Great and Small zu stammen scheint. Also das, was die Firma Ladage & Oelke den Hamburgern als typisch englisch verkauft. Und was man ein paar Straßen weiter bei Rudolf Beaufays etwas echter bekommen kann.
Natürlich kann man auf dem Land eine Spur eleganter sein, wie uns der eigentlich viel zu feine Sir Benjamin Truman auf dem Bild von Gainsborough zeigt. Aber selbst die weißen Seidenstrümpfe und die gelbe Weste wären für einen modebewußten Franzosen zu wenig an Mode. Wenn George III König wird, werden ihn satirische Journalisten Farmer George nennen. Und seine Untertanen werden diesen royalen Farmer kaum von einem anderen Großgrundbesitzer unterscheiden können. Wenn man im 18. Jahrhundert in Richmond deutsche Schweine und neuseeländische Schafe züchtet, läuft man nicht in Samt und Rüschenjabot herum.
George III hat Benjamin Truman zum Ritter geschlagen. Nicht, weil das Bier dieses Bierbrauers so gut war. Sondern weil Truman dem König George II Geld fürs Kriegführen geliehen hat. In jeder anderen Nation hätte sich ein Bierbrauer wahrscheinlich stolz vor seiner Bierbrauerei malen lassen, in England lässt er sich als country gentleman malen. Auch wenn er als nouveau riche die Rolle noch nicht so richtig beherrscht und zu elegant fürs Land ist. Truman ist typisch für eine neue Schicht, die ihren Reichtum nicht wie der Adel durch Erbschaft erwirbt. Die sich aber ansonsten verhält wie der Adel (neben seinem Haus in Spitalsfield hat Truman noch einen Landsitz in Hertingfordbury in Hertfordshire) und sich auch wie der Adel malen lässt.
Diese drei Herren auf Reynolds größtem conversation peace (für das er achtzig guineas bekam) verkörpern das alte Geld. Der junge Henry Fane in der Bildmitte wird zahlreiche politische Ämter innehaben, aber seine Zeitgenossen beschreiben ihn als very idle and careless and spending much time in the country. Links von ihm sitzt Inigo Jones, ein Nachfahre des Architekten, rechts von Fane steht sein Schwager Charles Blair. Der besitzt eine Zuckerplantage auf Jamaica und hat viele Sklaven. Vielleicht ist es doch moralischer, sein Geld als Bierbrauer zu verdienen. Charles Blairs ist übrigens der Ur-Ur-Großvater eines gewissen Eric Blair, der als George Orwell berühmt wird.
Je weiter das Jahrhundert fortschreitet, desto modischer scheint die Kleidung auf dem Land zu werden. Auf jeden Fall auf der Leinwand der Maler. Die ersten Zeichen des Dandyismus, Englands Antwort auf die französischen Incroyables, machen sich auch beim Fliegenfischen bemerkbar. Sein Bildnis des Lieutenant-Colonel Bryce McMurdo zeigt einen Mann in schlichtem Sportdreß‚ der sich ohne Pathos und Selbstgefälligkeit präsentiert, sagt ein gewisser Gottfried Lindemann in seinem Buch Kunst, Künstler, Kunstwerke: Malerei über das Bild von Sir Henry Raeburn. Schlichter Sportdress? Der Colonel mit seinem frock und seinen gelben Nanking Hosen könnte in jedem Londoner Salon Beau Brummell Konkurrenz machen (die modischen gelben Nanking Hosen wurden zum letzten Mal in diesem Blog hier erwähnt).
Ein klein wenig revolutionär (hier haben die Sansculotten offensichtlich in der Mode gesiegt) ist die Tatsache, das unser Colonel keine Kniehosen trägt (lesen Sie mehr dazu in dem Post Beinkleider). Das schöne Portrait von Raeburn sollte uns aber zugleich eine Warnung sein: wir wissen nicht, ob er beim Fliegenfischen wirklich so gekleidet war. Die Alltagswirklichkeit dringt selten in die Portraits des 18. Jahrhunderts ein. Die Pantalons von Colonel Bryce McMurdo sind sicher auf dem Land ungewöhnlich, viel eher wird man die gelben Reithosen finden, die hier (wieder ein Bild von Raeburn) Captain John Cunningham, der dreizehnte Laird of Craigends, trägt. Man beachte seinen kurzen, praktischen frock.
Ich weiß auch nicht, ob man im 18. Jahrhundert wirklich in solcher Kleidung Cricket gespielt hat. Auf dem Bild von Benjamin West, das The Cricketers heißt (manchmal auch Ralph Izard and His Friends), hat auf jeden Fall einer der Herren einen Cricketschläger in der Hand. Wir sind im Jahre 1764 und die Elite der Kolonien tummelt sich in London. Und die Gentlemen des Südens, die nicht in London sind, haben auf jeden Fall dort ihren Schneider. Wie zum Beispiel George Washington, der seinen Londoner Schneidern zwar genaue Anweisungen über den Stil des bestellten Kleidungsstückes gibt, ihn aber über seine Körpermaße im Unklaren lässt.
Es ist ja nicht so, dass die Engländer nicht elegant könnten. So schreibt John Macky am Anfang des Jahrhunderts in seinem Buch A Journey Through England: The dress of the English is like the French, but not so gaudy; they generally go plain, but in, the best cloths and stuffs, and wear the best linen of any nation in the world; not but they wear embroideries and lace on their clothes on solemn days, but they do not make it their daily wear as the French do. John Macky ist Schotte, für ihn sind die Engländer Ausländer. Und er beobachtet sie genau, und obwohl er von Beruf Spion ist, können wir seinen Beobachtungen vielleicht trauen.
Wenn es auch schlicht ist, es muss das Beste sein. Schließlich hat man Geschmack, der Begriff taste wird jetzt auch auf die Mode angewandt. Obgleich das Sir Joshua Reynolds nicht so ganz behagt: I have mentioned taste in dress, which is certainly one of the lowest subjects to which this word is applied. (Lesen Sie hier den letzten seiner Seven Discourses on Art). Die kleinen, unauffälligen Dinge werden jetzt wichtig, aber es wird noch zweihundert Jahre dauern, bis Stephen Bayley Taste: The Secret Meaning of Things schreibt.
Sir Joshua Reynolds hatte für die Maler die Losung von der grand manner ausgegeben, nicht alle englischen Maler werden ihm bei dieser gesuchten Großartigkeit folgen. Dies Bild von Augustus John Hervey, dem dritten Earl of Bristol, steht (wie auch Gainsboroughs Bild von John Plampin oben) in einem Gegensatz zu Reynolds Portrait von Lord Heathfield in Gibraltar oder Raeburns Portrait von Sir John Sinclair of Ulbster in der Uniform eines Colonels der Rothesay and Caithness Fencibles. Die beiden Herren sind in heldenhafter Pose gemalt, der an einen Anker gelehnten Commodore der Royal Navy strahlt dagegen eine gewisse Nonchalance aus. Thomas Gainsborough hat es nicht so mit dem Heldenhaften, er macht aus einem formellen Portrait ein eher informelles.
Wenn man adlig ist und gerade vor der Beförderung zum Admiral steht, dann kann man auch lässig dastehen und sich an den Erfolg in der Seeschlacht von Havanna erinnern. Zumal, wenn die aktive Zeit als Seeoffizier vorbei ist, von nun an ist der Lord, den man wegen seines Liebeslebens auch den englischen Casanova nennt, nur noch nominell in der Navy. Wenn man (noch) nicht adlig ist, aber auf dem Weg nach oben ist, dann steht man ebenso inszeniert lässig da. Wie hier der junge Nelson auf dem Portrait von John Francis Rigaud. Als der Maler das Portrait begann, war Nelson noch Lieutenant, als Nelson von der San Juan Expedition zurückkehrt, ist er Captain. Rigaud muss noch Goldbordüren an die Uniform und den Hut malen. Eigentlich war es kein Grund, die Aktion mit einem Gemälde zu feiern, die ganze Unternehmung war ein Desaster.
Zum Admiral wird es auch Captain Edward Vernon noch bringen. Er ist ein entfernter Verwandter des Admirals Vernon, dem die Welt den Grog verdankt und nach dem Washingtons Landsitz Mount Vernon heißt. Wenn sich die Herren in ihren schönen neuen Uniformen malen lassen, dann liegt das auch daran, dass es jetzt schöne neue Uniformen gibt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Royal Navy gibt es jetzt eine einheitliche Marineuniform. Die auch die zivile Herrenmode beeinflusst. Und anders herum.
Mehr dazu kann man dem hervorragenden Buch Dressed to Kill: British Naval Uniforms, Masculinity and Contemporary Fashions 1748-1857 von Amy Miller entnehmen. Captain Vernons Uniform auf dem Bild von Francis Hayman lässt einen höheren Dienstgrad vermuten als den, den John Plampin auf dem Bild von Gainsborough oben hat. Wenn man so ordinär breitbeinig dasitzt (wenn selbst der Hund im Vordergrund seinen Herrn kritisch betrachtet), dann macht man keine Karriere in der Royal Navy. Macht er auch nicht, aber sein Sohn Robert Plampin, der wird noch Admiral. Zu seinen Pflichten wird es eines Tages gehören, auf Napoleon in St Helena aufzupassen.
Die englischen Gentlemen, die sich im 18. Jahrhundert malen lassen, lassen sich gerne auf dem Höhepunkt ihrer Karriere malen. Ob in Uniform oder Zivil, das Studio des Malers hat Fachleute, die auf alle modischen Detailfragen vorbereitet sind. Von den Knöpfen bis zu den Goldborten. In den meisten Fällen malt der Maler die elegante Kleidung nicht selbst, das tun die spezialisierten Assistenten. Solche Gehilfen haben im 18. Jahrhunderts beinahe alle englischen Maler: für die Kleidung, für den Hintergrund, selbst für die Pferde, die manche der Portraitierten mitbringen. Der Herr auf diesem Bild wollte keine Verschönerung durch den Maler, er wollte so sein, wie er wirklich war. Und sein Freund William Hogarth hat den Captain Thomas Coram mit seinem greatcoat (auch surtout genannt) dann genau so gemalt.
Mit unordentlich zugeknöpfter Weste (die Knöpfe der Weste von Sir Benjamin Truman sind auch nicht alle zugeknöpft) und verrutschten Hosen, das königliche Siegel für die Charter des von ihm gegründeten Waisenhauses fest in der Hand. Er hat sein Vermögen mit Schiffen und der Seefahrt gemacht, jetzt tut er gute Werke. Auch wenn er in der Pose eines Herrschers gemalt ist, er wirkt eher wie ein guter Kumpel. Dieses Bild hat nichts mit Reynolds grand manner zu tun, dieser Mann ist einfach normal. Hogarth (der kein Honorar für sein Bild nahm) war stolz auf das Bild: The portrait which I painted with most pleasure and in which I particularly wished to excel, was that of Captain Coram for the Foundling Hospital; and if I am so wretched an artist as my enemies assert, it is somewhat strange that this, which was one of the first I painted the size of life, should stand the test of twenty years' competition, and be generally thought the best portrait in the place, notwithstanding the first painters in the kingdom exerted all their talents to vie with it.
Das 18. Jahrhundert bringt nicht nur eine neue Mode für die neue englische Gesellschaft, es bringt auch die ersten Modezeitschriften. Und es bringt Philosophen wie Christian Garve, die über die Mode schreiben. Und es fehlt natürlich nicht an Benimmbüchern. Die hat es über die Jahrhunderte immer gegeben, auf jeden Fall seit die Menschheit Wildschweine nicht mehr so aß wie Obelix. Aber war eins dieser Bücher so erfolgreich wie die gesammelten Briefe, die Lord Chesterfield (Bild) seinem Sohn schreibt? Nicht für alle Zeitgenossen waren die Belehrungen von der Bedeutung, wie sie heute manchmal eingeschätzt wurden. ➱Samuel Johnson sagte über sie, they teach the morals of a whore, and the manners of a dancing-master. Aber ich möchte dennoch einen Absatz daraus zitieren:
Your dress (as insignificant a thing as dress is in itself) is now become an object worthy of some attention; for, I confess, I cannot help forming some opinion of a man's sense and character from his dress; and I believe most people do as well as myself. Any affectation whatsoever in dress implies, in my mind, a flaw in the understanding. Most of our young fellows here display some character or other by their dress; some affect the tremendous, and wear a great and fiercely cocked hat, an enormous sword, a short waistcoat and a black cravat; these I should be almost tempted to swear the peace against, in my own defense, if I were not convinced that they are but meek asses in lions' skins. Others go in brown frocks, leather breeches, great oaken cudgels in their hands, their hats uncocked, and their hair unpowdered; and imitate grooms, stage-coachmen, and country bumpkins so well in their outsides, that I do not make the least doubt of their resembling them equally in their insides.
Der junge Doktor C. Willett Cunnington war Stabsarzt im Ersten Weltkrieg, als er aus dem Krieg zurückkam, heiratete er die Ärztin Phillis Webb. Gemeinsam betrieben sie ihre Praxis in Finchley, und gemeinsam begannen sie, Kleidung zu sammeln. Die sie in einer Scheune im Garten horteten. Der Hang zum Sammeln könnte daran liegen, dass Dr Cunnington aus einer Familie von Archäologen stammte. 1935 erschien mit Feminine Attitudes das erste Buch des Sammlers, danach hörte es mit dem Schreiben nicht mehr auf.
Seine Frau Phillis brachte etwas dann mehr Wissenschaftlichkeit in die gemeinsamen Schriften, von ihm stammte der Humor, den die Leser an den Büchern so schätzten. 1947 verkauften die Cunningtons ihre Sammlung an die Stadt Manchester, sie ist heute die Basis der Gallery of Costume in der Platt Hall, einem schönen Landsitz im Georgian Style. Das Handbook of English Costume in the Eighteenth Century der beiden ist natürlich das Standardwerk für das 18. Jahrhundert. Leider bleibt dieses vom Markt verschwundene Buch so gut wie unerschwinglich, es wird Sie nicht trösten, dass ich für mein Exemplar zehn Euro bezahlt habe.
Sie vermissen die Damenmode? Vielleicht kommt die noch eines Tages. Bis dahin benutzen Sie doch diese schöne interaktive Seite des Victoria & Albert Museums.
Die Wolle wird im 18. Jahrhundert bei den Röcken der Herren peu à peu die Seide verdrängen. Am Ende des Jahrhunderts wird George III auch bei offiziellen Empfängen broadcloth statt Samt oder Seide tragen. Und er hat nichts dagegen, wenn sein Premierminister Pitt im braunen Wollanzug in den Palast kommt. Als George Washington sein Amt als erster amerikanischer Präsident antritt, wird er einen Anzug aus amerikanischer Wolle tragen, keinen Rock aus Samt oder Seide. Sie könnten jetzt hier den langen Post George Washington (sartorial) lesen.
Der wichtigste Import aus dem immer größer werdenden Empire ist die Baumwolle aus Indien, die die heimischen Marktstrukturen verändert. Manchester wird zum wichtigsten industriellen Zentrum der Welt, die Baumwolle wird beinahe zu einer Religion. Auf jeden Fall in den Worten des alten Dubslav von Stechlin in Fontanes Roman: Sie sind drüben schrecklich runtergekommen, weil der Kult vor dem Goldenen Kalbe beständig wächst; lauter Jobber, und die vornehmen Leute obenan. Und dabei so heuchlerisch; sie sagen Christus und meinen Kattun. Fontane kannte das England, über das er schrieb. Ein Deutscher, der lange in Manchester gelebt hat, wird Die Lage der arbeitenden Klasse in England schreiben.
Aus Indien kommt nicht nur die Baumwolle, von dort kommt auch Kaschmir nach England. Zumeist in der Form von Shawls. Im schottischen Paisley (aber auch in Norwich, lesen Sie hier alles dazu) entsteht jetzt ein Zentrum für die Produktion von Cashmere Shawls. Die nicht aus Kaschmir, sondern aus Wolle sind, aber das typische Muster haben, das wir bis heute als Paisley kennen. Dieses Bild von John Singleton Copley zeigt die Gattin von General Gage (die hier schon einmal erwähnt wurde) mit einem hochmodischen Paisley Kopfschmuck. Der wahrscheinlich aus Indien und nicht aus Schottland stammt. Nach Meinung der englischen Professorin Eileen Ribeiro ist dies vielleicht ein Kopfschmuck aus der Türkei, der gerne bei Londoner Kostümfesten getragen wurde.
Die Herrenmode Englands findet in Europa Beachtung, weil die reisenden Engländer ihre Mode auch in andere Länder tragen. Die Engländer schauen allerdings schon darauf, was in Paris getragen wird, und Pariser Seidenwesten für den Herrn sind ein beliebter Schmuggelartikel der englischen Gentlemen. Dies Bild von Gainsborough zeigt natürlich keinen englischen Zollspürhund beim Erschnüffeln einer französischen Weste, es zeigt Lord George Vernon im dreiteiligen Anzug, dem Justacorps, den die englische Mode seit Charles II kennt.
Eigentlich brauchte man gar keine Westen aus Frankreich zu schmuggeln. Die Seidenweberei in Spitalsfield, die am Ende des 17. Jahrhunderts von französischen Hugenotten begründet wurde, hat im 18. Jahrhundert einen Höhepunkt. Und die Qualität der englischen Seide ist so gut, dass sie für die Italiener begehrenswert ist (die dann natürlich englische Seide schmuggeln). Seit den 1730er Jahren sind noch irische Leinenweber nach Spitalsfield gekommen, die den Hugenotten Konkurrenz machten. Die erwächst dem traditionellen Handwerk der Seidenweber auch durch die aus Indien importierten billigen Baumwollstoffe. Das Weltreich, das England sich jetzt erobert ist - wenn man so will - auch der Beginn der Globalisierung. Die Auseinandersetzungen zwischen Hugenotten und Iren werden zu erbitterten Arbeitskämpfen führen, deren Höhepunkt 1769 die Spitalfield Riots sind. Da hängt man einen Hugenotten und einen Iren auf, dann ist erst einmal Ruhe.
Der Engländer des 18. Jahrhunderts gibt sich auf dem Land ein wenig nachlässig, man passt sich dem Stil der gentry an. Zum einen ist es praktisch, zum anderen möchte man die modisch überdrehten französischen Froschfresser ja nicht imitieren. Das überlässt man anderen. Zum Beispiel der neuen, reich gewordenen bürgerlichen Schicht. Und natürlich dem schönen Geschlecht. Im Jahre 1730 notiert ein portugiesischer Kaufmann namens Don Manuel Gonzales über die Kleidung der englischen Herren: for raiment, the common wear amongst the men is plain cloth and drugget, without any thing of costly ornament. Und César de Saussure schreibt in seinen Letters from London (als Briefe über London 1792 in Hamburg erschienen), dass die englischen Gentlemen keinen Goldschmuck (und keine Zierdegen) trügen. Das auf dem Bild ist übrigens der siebte Lord Vernon, im Jahre 1854 von dem Amerikaner Julian Russell Story gemalt. Ähnlichkeiten in der Kleidung der beiden Lords sind nicht rein zufällig.
Der französische Abbé Jean-Bernard Le Blanc (Bild), der 1737 von einem englischen Adligen eingeladen wurde, hat uns in einer Vielzahl von Briefen ein Sittenbild der englischen Gesellschaft geliefert. Zuerst in Frankreich erschienen, gab es das Buch 1747 auch in englischer Übersetzung. Letters on the English and French nations : containing curious and useful observations on their constitutions natural and political : nervous and humorous descriptions of the virtues, vices, ridicules and foibles of the inhabitants : critical remarks on their writers : together with moral reflections interspersed throughout the work war eine Art Bestseller des 18. Jahrhunderts. Und was sagt er über das dressing down der Engländer? Es gefällt ihm nicht: masters dress like their valets; duchesses copy their chamber-maids.
Selbstverständlich gibt es Gelegenheiten, bei denen die Engländer ganz anders auftreten. So schreibt der amerikanische Botschafter Richard Rush zu Anfang des 19. Jahrhunderts über einen Empfang bei der Königin Charlotte: If the scene in the hall was picturesque, the one upstairs transcended it. The doors of the rooms were all open. You saw in them a thousand ladies richly dressed. All the colours of nature were mingling their rays together. It was the first occasion of laying by mourning for the Princess Charlotte; so that it was like the bursting out of spring. No lady was without her plume. The whole was a waving field of feathers. Some were blue, like the sky; some tinged with red; here you saw violet and yellow; there, shades of green. But the most were like tufts of snow. The diamonds encircling them, caught the sun through the windows, and threw dazzling beams around. Then the hoops! I cannot describe these. They should be seen. To see one is nothing. But to see a thousand — and their thousand wearers! I afterwards sat in the ambassadors' box at a coronation. That sight faded before this.
Noch verfügt die Gesellschaft für das Theater des Lebens über verschiedene Rollenrepertoires - heute ist das, wie Richard Sennett in The Fall of Public Man beklagt, kaum noch so. Man kleidet sich im eigenen Haus anders als für den Ball bei der Königin. Und man kleidet sich für den Morgenritt oder die Jagd anders als für die Stadt, anders als für den Beruf oder für ein Diner in feiner Gesellschaft. Für all das hat man ein Kostüm, ebenso wie man für all diese Gelegenheiten ein Repertoire der Umgangsformen besitzt. Das Wort negligé bedeutet im 18. Jahrhundert etwas anderes als es heute bedeutet. Es hat noch nichts mit der Reizwäsche zu tun, es ist lediglich etwas, was wir heute als dressing down bezeichnen.Auf dem Land kann man den englischen Gentleman kaum von seinen Gutsverwalter und Wildhütern unterscheiden. Der frock, den die gentry ab 1730 von den Landbewohnern übernimmt (und der sich von dem damals vorherrschen Anzug dadurch unterscheidet, dass er einen Kragen und ein Revers hat) wird kürzer. Die lange Weste wird verdrängt durch den kürzeren gemusterten Newmarket waistcoat. Die karierten Tattersall Westen, die man in englischen Filmen sehen kann, sind die modernen Vertreter dieser Weste. Auf dem Bild Thomas Nuthall with a Dog and Gun von Sir Nathaniel Dance-Holland (oben) sehen wir einen upper class Gentleman bei der liebsten Freizeitbeschäftigung der Engländer. Seine Kleidung ist ziemlich unspektakulär und sicher praktisch. Zwischen dem Bild Sir Nathaniel Dance-Hollands und diesem Werbephoto liegen Jahrhunderte, aber der Stil bleibt der gleiche.
Der country gentleman wird zu einem modischen Ideal des 18. Jahrhunderts. Und das ist er vielleicht noch heute. Die weltweit verkaufte Englishness ist ja weniger die Kleidung der Londoner City als ein tradiertes Ideal, das aus dem Moderepertoire der TV Verfilmung von James Herriots All Creatures Great and Small zu stammen scheint. Also das, was die Firma Ladage & Oelke den Hamburgern als typisch englisch verkauft. Und was man ein paar Straßen weiter bei Rudolf Beaufays etwas echter bekommen kann.
Natürlich kann man auf dem Land eine Spur eleganter sein, wie uns der eigentlich viel zu feine Sir Benjamin Truman auf dem Bild von Gainsborough zeigt. Aber selbst die weißen Seidenstrümpfe und die gelbe Weste wären für einen modebewußten Franzosen zu wenig an Mode. Wenn George III König wird, werden ihn satirische Journalisten Farmer George nennen. Und seine Untertanen werden diesen royalen Farmer kaum von einem anderen Großgrundbesitzer unterscheiden können. Wenn man im 18. Jahrhundert in Richmond deutsche Schweine und neuseeländische Schafe züchtet, läuft man nicht in Samt und Rüschenjabot herum.
George III hat Benjamin Truman zum Ritter geschlagen. Nicht, weil das Bier dieses Bierbrauers so gut war. Sondern weil Truman dem König George II Geld fürs Kriegführen geliehen hat. In jeder anderen Nation hätte sich ein Bierbrauer wahrscheinlich stolz vor seiner Bierbrauerei malen lassen, in England lässt er sich als country gentleman malen. Auch wenn er als nouveau riche die Rolle noch nicht so richtig beherrscht und zu elegant fürs Land ist. Truman ist typisch für eine neue Schicht, die ihren Reichtum nicht wie der Adel durch Erbschaft erwirbt. Die sich aber ansonsten verhält wie der Adel (neben seinem Haus in Spitalsfield hat Truman noch einen Landsitz in Hertingfordbury in Hertfordshire) und sich auch wie der Adel malen lässt.
Diese drei Herren auf Reynolds größtem conversation peace (für das er achtzig guineas bekam) verkörpern das alte Geld. Der junge Henry Fane in der Bildmitte wird zahlreiche politische Ämter innehaben, aber seine Zeitgenossen beschreiben ihn als very idle and careless and spending much time in the country. Links von ihm sitzt Inigo Jones, ein Nachfahre des Architekten, rechts von Fane steht sein Schwager Charles Blair. Der besitzt eine Zuckerplantage auf Jamaica und hat viele Sklaven. Vielleicht ist es doch moralischer, sein Geld als Bierbrauer zu verdienen. Charles Blairs ist übrigens der Ur-Ur-Großvater eines gewissen Eric Blair, der als George Orwell berühmt wird.
Je weiter das Jahrhundert fortschreitet, desto modischer scheint die Kleidung auf dem Land zu werden. Auf jeden Fall auf der Leinwand der Maler. Die ersten Zeichen des Dandyismus, Englands Antwort auf die französischen Incroyables, machen sich auch beim Fliegenfischen bemerkbar. Sein Bildnis des Lieutenant-Colonel Bryce McMurdo zeigt einen Mann in schlichtem Sportdreß‚ der sich ohne Pathos und Selbstgefälligkeit präsentiert, sagt ein gewisser Gottfried Lindemann in seinem Buch Kunst, Künstler, Kunstwerke: Malerei über das Bild von Sir Henry Raeburn. Schlichter Sportdress? Der Colonel mit seinem frock und seinen gelben Nanking Hosen könnte in jedem Londoner Salon Beau Brummell Konkurrenz machen (die modischen gelben Nanking Hosen wurden zum letzten Mal in diesem Blog hier erwähnt).
Ich weiß auch nicht, ob man im 18. Jahrhundert wirklich in solcher Kleidung Cricket gespielt hat. Auf dem Bild von Benjamin West, das The Cricketers heißt (manchmal auch Ralph Izard and His Friends), hat auf jeden Fall einer der Herren einen Cricketschläger in der Hand. Wir sind im Jahre 1764 und die Elite der Kolonien tummelt sich in London. Und die Gentlemen des Südens, die nicht in London sind, haben auf jeden Fall dort ihren Schneider. Wie zum Beispiel George Washington, der seinen Londoner Schneidern zwar genaue Anweisungen über den Stil des bestellten Kleidungsstückes gibt, ihn aber über seine Körpermaße im Unklaren lässt.
Es ist ja nicht so, dass die Engländer nicht elegant könnten. So schreibt John Macky am Anfang des Jahrhunderts in seinem Buch A Journey Through England: The dress of the English is like the French, but not so gaudy; they generally go plain, but in, the best cloths and stuffs, and wear the best linen of any nation in the world; not but they wear embroideries and lace on their clothes on solemn days, but they do not make it their daily wear as the French do. John Macky ist Schotte, für ihn sind die Engländer Ausländer. Und er beobachtet sie genau, und obwohl er von Beruf Spion ist, können wir seinen Beobachtungen vielleicht trauen.
Wenn es auch schlicht ist, es muss das Beste sein. Schließlich hat man Geschmack, der Begriff taste wird jetzt auch auf die Mode angewandt. Obgleich das Sir Joshua Reynolds nicht so ganz behagt: I have mentioned taste in dress, which is certainly one of the lowest subjects to which this word is applied. (Lesen Sie hier den letzten seiner Seven Discourses on Art). Die kleinen, unauffälligen Dinge werden jetzt wichtig, aber es wird noch zweihundert Jahre dauern, bis Stephen Bayley Taste: The Secret Meaning of Things schreibt.
Sir Joshua Reynolds hatte für die Maler die Losung von der grand manner ausgegeben, nicht alle englischen Maler werden ihm bei dieser gesuchten Großartigkeit folgen. Dies Bild von Augustus John Hervey, dem dritten Earl of Bristol, steht (wie auch Gainsboroughs Bild von John Plampin oben) in einem Gegensatz zu Reynolds Portrait von Lord Heathfield in Gibraltar oder Raeburns Portrait von Sir John Sinclair of Ulbster in der Uniform eines Colonels der Rothesay and Caithness Fencibles. Die beiden Herren sind in heldenhafter Pose gemalt, der an einen Anker gelehnten Commodore der Royal Navy strahlt dagegen eine gewisse Nonchalance aus. Thomas Gainsborough hat es nicht so mit dem Heldenhaften, er macht aus einem formellen Portrait ein eher informelles.
Wenn man adlig ist und gerade vor der Beförderung zum Admiral steht, dann kann man auch lässig dastehen und sich an den Erfolg in der Seeschlacht von Havanna erinnern. Zumal, wenn die aktive Zeit als Seeoffizier vorbei ist, von nun an ist der Lord, den man wegen seines Liebeslebens auch den englischen Casanova nennt, nur noch nominell in der Navy. Wenn man (noch) nicht adlig ist, aber auf dem Weg nach oben ist, dann steht man ebenso inszeniert lässig da. Wie hier der junge Nelson auf dem Portrait von John Francis Rigaud. Als der Maler das Portrait begann, war Nelson noch Lieutenant, als Nelson von der San Juan Expedition zurückkehrt, ist er Captain. Rigaud muss noch Goldbordüren an die Uniform und den Hut malen. Eigentlich war es kein Grund, die Aktion mit einem Gemälde zu feiern, die ganze Unternehmung war ein Desaster.
Zum Admiral wird es auch Captain Edward Vernon noch bringen. Er ist ein entfernter Verwandter des Admirals Vernon, dem die Welt den Grog verdankt und nach dem Washingtons Landsitz Mount Vernon heißt. Wenn sich die Herren in ihren schönen neuen Uniformen malen lassen, dann liegt das auch daran, dass es jetzt schöne neue Uniformen gibt. Zum ersten Mal in der Geschichte der Royal Navy gibt es jetzt eine einheitliche Marineuniform. Die auch die zivile Herrenmode beeinflusst. Und anders herum.
Mehr dazu kann man dem hervorragenden Buch Dressed to Kill: British Naval Uniforms, Masculinity and Contemporary Fashions 1748-1857 von Amy Miller entnehmen. Captain Vernons Uniform auf dem Bild von Francis Hayman lässt einen höheren Dienstgrad vermuten als den, den John Plampin auf dem Bild von Gainsborough oben hat. Wenn man so ordinär breitbeinig dasitzt (wenn selbst der Hund im Vordergrund seinen Herrn kritisch betrachtet), dann macht man keine Karriere in der Royal Navy. Macht er auch nicht, aber sein Sohn Robert Plampin, der wird noch Admiral. Zu seinen Pflichten wird es eines Tages gehören, auf Napoleon in St Helena aufzupassen.
Die englischen Gentlemen, die sich im 18. Jahrhundert malen lassen, lassen sich gerne auf dem Höhepunkt ihrer Karriere malen. Ob in Uniform oder Zivil, das Studio des Malers hat Fachleute, die auf alle modischen Detailfragen vorbereitet sind. Von den Knöpfen bis zu den Goldborten. In den meisten Fällen malt der Maler die elegante Kleidung nicht selbst, das tun die spezialisierten Assistenten. Solche Gehilfen haben im 18. Jahrhunderts beinahe alle englischen Maler: für die Kleidung, für den Hintergrund, selbst für die Pferde, die manche der Portraitierten mitbringen. Der Herr auf diesem Bild wollte keine Verschönerung durch den Maler, er wollte so sein, wie er wirklich war. Und sein Freund William Hogarth hat den Captain Thomas Coram mit seinem greatcoat (auch surtout genannt) dann genau so gemalt.
Mit unordentlich zugeknöpfter Weste (die Knöpfe der Weste von Sir Benjamin Truman sind auch nicht alle zugeknöpft) und verrutschten Hosen, das königliche Siegel für die Charter des von ihm gegründeten Waisenhauses fest in der Hand. Er hat sein Vermögen mit Schiffen und der Seefahrt gemacht, jetzt tut er gute Werke. Auch wenn er in der Pose eines Herrschers gemalt ist, er wirkt eher wie ein guter Kumpel. Dieses Bild hat nichts mit Reynolds grand manner zu tun, dieser Mann ist einfach normal. Hogarth (der kein Honorar für sein Bild nahm) war stolz auf das Bild: The portrait which I painted with most pleasure and in which I particularly wished to excel, was that of Captain Coram for the Foundling Hospital; and if I am so wretched an artist as my enemies assert, it is somewhat strange that this, which was one of the first I painted the size of life, should stand the test of twenty years' competition, and be generally thought the best portrait in the place, notwithstanding the first painters in the kingdom exerted all their talents to vie with it.
Das 18. Jahrhundert bringt nicht nur eine neue Mode für die neue englische Gesellschaft, es bringt auch die ersten Modezeitschriften. Und es bringt Philosophen wie Christian Garve, die über die Mode schreiben. Und es fehlt natürlich nicht an Benimmbüchern. Die hat es über die Jahrhunderte immer gegeben, auf jeden Fall seit die Menschheit Wildschweine nicht mehr so aß wie Obelix. Aber war eins dieser Bücher so erfolgreich wie die gesammelten Briefe, die Lord Chesterfield (Bild) seinem Sohn schreibt? Nicht für alle Zeitgenossen waren die Belehrungen von der Bedeutung, wie sie heute manchmal eingeschätzt wurden. ➱Samuel Johnson sagte über sie, they teach the morals of a whore, and the manners of a dancing-master. Aber ich möchte dennoch einen Absatz daraus zitieren:
Your dress (as insignificant a thing as dress is in itself) is now become an object worthy of some attention; for, I confess, I cannot help forming some opinion of a man's sense and character from his dress; and I believe most people do as well as myself. Any affectation whatsoever in dress implies, in my mind, a flaw in the understanding. Most of our young fellows here display some character or other by their dress; some affect the tremendous, and wear a great and fiercely cocked hat, an enormous sword, a short waistcoat and a black cravat; these I should be almost tempted to swear the peace against, in my own defense, if I were not convinced that they are but meek asses in lions' skins. Others go in brown frocks, leather breeches, great oaken cudgels in their hands, their hats uncocked, and their hair unpowdered; and imitate grooms, stage-coachmen, and country bumpkins so well in their outsides, that I do not make the least doubt of their resembling them equally in their insides.
A man of sense carefully avoids any particular character in his dress; he is accurately clean for his own sake; but all the rest is for other people's. He dresses as well, and in the same manner, as the people of sense and fashion of the place where he is. If he dresses better, as he thinks, that is, more than they, he is a fop; if he dresses worse, he is unpardonably negligent. But, of the two, I would rather have a young fellow too much than too little dressed; the excess on that side will wear off, with a little age and reflection; but if he is negligent at twenty, he will be a sloven at forty, and stink at fifty years old.
Dress yourself fine, where others are fine; and plain where others are plain; but take care always that your clothes are well made, and fit you, for otherwise they will give you a very awkward air. When you are once well dressed for the day think no more of it afterward; and, without any stiffness for fear of discomposing that dress, let all your motions be as easy and natural as if you had no clothes on at all. So much for dress, which I maintain to be a thing of consequence in the polite world. Ich nehme an, dass die Schneider der Savile Row diesen Text auswendig aufsagen können. Diese drei Gentlemen wurden von Hugh Douglas Hamilton, von Henry Walton und von Gainsborough gemalt.
Die Mode des ausgehenden Jahrhunderts und der Zeit des Regency hat die Modehistoriker mehr interessiert als die Jahrzehnte zuvor. Was an dem Auftreten eines neuen Wesens liegt (das man zum Teil auch durch die Grand Tour eingeschleppt hat): There is indeed a kind of animal, neither male nor female, a thing of the neuter gender, lately started up amongst us. It is called Macaroni. It talks without meaning, it smiles without pleasantry, it eats without appetite, it rides without exercise, it wenches without passion. Schon 1764 ätzt Horace Walpole über den Macaroni Club: The Maccaroni Club (which is composed of all the travelled young men who wear long curls and spying-glasses), und neun Jahre später wird er ausrufen: What is England now? – A sink of Indian wealth, filled by nabobs and emptied by Maccaronis! A senate sold and despised! A country overrun by horse-races! A gaming, robbing, wrangling, railing nation without principles, genius, character or allies.
Die englischen Macaronis (die natürlich noch lange nicht so schlimm sind wie ihre Pariser Verwandten, die Incroyables heißen) mutieren dann irgendwann in den englischen Dandy. Eine Sozialfigur, die es auch in den amerikanischen Kolonien zu geben scheint (lesen Sie dazu Amerikanische Dandies). Über die Figur des Dandy ist viel geschrieben worden, natürlich auch von jenen Dandies, die selbst Schriftsteller waren. Wie Barbey d'Aurevilly, Baudelaire oder Edward Bulwer-Lytton. Häufig ist das besser zu lesen, als was von Akademikern oder Feuilletonisten über den Dandy verfasst wird. Zumal sich die Akademiker auch nicht einigen können, welche Fakultät sich mit den Dandies beschäftigen soll. Man kann das in der Romanistik ansiedeln, dann wäre Professor Hans Hinterhäuser einer der ersten gewesen, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Man kann von der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft herkommen wie Hiltrud Gnüg mit ihrem Buch Kult der Kälte, einem leider sprachlich nicht ansprechenden und sachlich fehlerhaftem Werk. Oder man kann das Thema von der jetzt neu etablierten Kulturwissenschaft her angehen - wenn man es nicht dem Feuilleton oder Karl Lagerfeld überlassen will.
Und von der Kulturwissenschaft kommt Günter Erbe, und sein Buch Dandys - Virtuosen der Lebenskunst: Eine Geschichte des mondänen Lebens ist seit langer Zeit das Seriöseste, was über die Dandies geschrieben worden ist. Es beginnt mit Beau Brummell (obgleich man sich hier vielleicht ein erstes Kapitel über die ersten Regungen des Dandyismus im ausgehenden 18. Jahrundert gewünscht hätte) und endet mit der Zeit von Marcel Proust. Führt dann aber noch das Thema mit einem Ausblick auf den Dandy im Zeitalter der Massenkultur weiter. Das Buch besitzt eine vorzügliche Bibliographie - da haben die Möchtegern Dandy-Theoretiker noch viel zu tun, bis sie sich da durch gearbeitet haben. Und zu allerletzt: dies Buch ist nicht nur seriöse Kulturwissenschaft, es ist auch gut zu lesen! Da sagen wir doch chapeau! und ziehen unseren seidenen Zylinder. Und stellen ihn so auf dem Boden ab, wie Marcel Proust das in A la recherche du temps perdu beschreibt.
Die Bilderwelt des 18. Jahrhunderts offeriert uns die swagger portraits der Reichen und Schönen und die in Lumpen gehüllten Außenseiter in Hogarth' Gin Lane. Aber es gibt etwas dazwischen. Dies Detail aus George Morelands Bild A Windy Day (das ganze Bild gab es hier zu sehen) verwendet John Styles in seinem Buch The Dress of the People: Everyday Fashion in Eighteenth-Century England, das 2007 bei der Yale UP erschien. Styles hat lange für das Victoria & Albert Museum gearbeitet, er versteht etwas davon, worüber er schreibt. Ich sage das, weil in den letzten Jahren mehrere Bücher zur englischen Herrenmode des 18. Jahrhunderts erschienen sind, deren Verfasser keine Ahnung von Mode und Kostümkunde haben. Aber dafür von poststrukturalistischer Theorie. Zu dem vorzüglichen Buch von John Styles habe ichhier eine längere Buchbesprechung.Dress yourself fine, where others are fine; and plain where others are plain; but take care always that your clothes are well made, and fit you, for otherwise they will give you a very awkward air. When you are once well dressed for the day think no more of it afterward; and, without any stiffness for fear of discomposing that dress, let all your motions be as easy and natural as if you had no clothes on at all. So much for dress, which I maintain to be a thing of consequence in the polite world. Ich nehme an, dass die Schneider der Savile Row diesen Text auswendig aufsagen können. Diese drei Gentlemen wurden von Hugh Douglas Hamilton, von Henry Walton und von Gainsborough gemalt.
Die Mode des ausgehenden Jahrhunderts und der Zeit des Regency hat die Modehistoriker mehr interessiert als die Jahrzehnte zuvor. Was an dem Auftreten eines neuen Wesens liegt (das man zum Teil auch durch die Grand Tour eingeschleppt hat): There is indeed a kind of animal, neither male nor female, a thing of the neuter gender, lately started up amongst us. It is called Macaroni. It talks without meaning, it smiles without pleasantry, it eats without appetite, it rides without exercise, it wenches without passion. Schon 1764 ätzt Horace Walpole über den Macaroni Club: The Maccaroni Club (which is composed of all the travelled young men who wear long curls and spying-glasses), und neun Jahre später wird er ausrufen: What is England now? – A sink of Indian wealth, filled by nabobs and emptied by Maccaronis! A senate sold and despised! A country overrun by horse-races! A gaming, robbing, wrangling, railing nation without principles, genius, character or allies.
Die englischen Macaronis (die natürlich noch lange nicht so schlimm sind wie ihre Pariser Verwandten, die Incroyables heißen) mutieren dann irgendwann in den englischen Dandy. Eine Sozialfigur, die es auch in den amerikanischen Kolonien zu geben scheint (lesen Sie dazu Amerikanische Dandies). Über die Figur des Dandy ist viel geschrieben worden, natürlich auch von jenen Dandies, die selbst Schriftsteller waren. Wie Barbey d'Aurevilly, Baudelaire oder Edward Bulwer-Lytton. Häufig ist das besser zu lesen, als was von Akademikern oder Feuilletonisten über den Dandy verfasst wird. Zumal sich die Akademiker auch nicht einigen können, welche Fakultät sich mit den Dandies beschäftigen soll. Man kann das in der Romanistik ansiedeln, dann wäre Professor Hans Hinterhäuser einer der ersten gewesen, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Man kann von der Neueren Deutschen Literaturwissenschaft herkommen wie Hiltrud Gnüg mit ihrem Buch Kult der Kälte, einem leider sprachlich nicht ansprechenden und sachlich fehlerhaftem Werk. Oder man kann das Thema von der jetzt neu etablierten Kulturwissenschaft her angehen - wenn man es nicht dem Feuilleton oder Karl Lagerfeld überlassen will.
Und von der Kulturwissenschaft kommt Günter Erbe, und sein Buch Dandys - Virtuosen der Lebenskunst: Eine Geschichte des mondänen Lebens ist seit langer Zeit das Seriöseste, was über die Dandies geschrieben worden ist. Es beginnt mit Beau Brummell (obgleich man sich hier vielleicht ein erstes Kapitel über die ersten Regungen des Dandyismus im ausgehenden 18. Jahrundert gewünscht hätte) und endet mit der Zeit von Marcel Proust. Führt dann aber noch das Thema mit einem Ausblick auf den Dandy im Zeitalter der Massenkultur weiter. Das Buch besitzt eine vorzügliche Bibliographie - da haben die Möchtegern Dandy-Theoretiker noch viel zu tun, bis sie sich da durch gearbeitet haben. Und zu allerletzt: dies Buch ist nicht nur seriöse Kulturwissenschaft, es ist auch gut zu lesen! Da sagen wir doch chapeau! und ziehen unseren seidenen Zylinder. Und stellen ihn so auf dem Boden ab, wie Marcel Proust das in A la recherche du temps perdu beschreibt.
Der junge Doktor C. Willett Cunnington war Stabsarzt im Ersten Weltkrieg, als er aus dem Krieg zurückkam, heiratete er die Ärztin Phillis Webb. Gemeinsam betrieben sie ihre Praxis in Finchley, und gemeinsam begannen sie, Kleidung zu sammeln. Die sie in einer Scheune im Garten horteten. Der Hang zum Sammeln könnte daran liegen, dass Dr Cunnington aus einer Familie von Archäologen stammte. 1935 erschien mit Feminine Attitudes das erste Buch des Sammlers, danach hörte es mit dem Schreiben nicht mehr auf.
Seine Frau Phillis brachte etwas dann mehr Wissenschaftlichkeit in die gemeinsamen Schriften, von ihm stammte der Humor, den die Leser an den Büchern so schätzten. 1947 verkauften die Cunningtons ihre Sammlung an die Stadt Manchester, sie ist heute die Basis der Gallery of Costume in der Platt Hall, einem schönen Landsitz im Georgian Style. Das Handbook of English Costume in the Eighteenth Century der beiden ist natürlich das Standardwerk für das 18. Jahrhundert. Leider bleibt dieses vom Markt verschwundene Buch so gut wie unerschwinglich, es wird Sie nicht trösten, dass ich für mein Exemplar zehn Euro bezahlt habe.
Sie vermissen die Damenmode? Vielleicht kommt die noch eines Tages. Bis dahin benutzen Sie doch diese schöne interaktive Seite des Victoria & Albert Museums.























._by_Francis_Hayman.jpg)
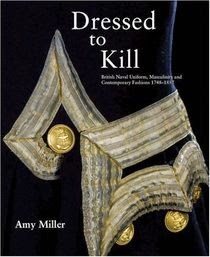













Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen