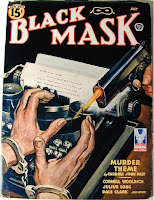Viermal hatte die kleine Penelope dem berühmten Maler Sir Joshua Reynolds in der ersten Juliwoche 1788 Modell sitzen müssen, dann war das Portrait fertig. Daddy hatte schon im voraus bezahlt, fünfzig Pfund hatte das Ganze gekostet. Im Januar hatte der Vater der kleinen Penelope, der sich natürlich auch von Reynolds hatte ➱
malen lassen, aus Paris an Reynolds geschrieben. Ob er nicht eine Ausstellung der Bilder von Jacques-Louis David in der Royal Academy organisieren könne? Wir wissen, dass aus diesem künstlerisch völkerverbindenden Plan nichts geworden ist, aber wir kennen natürlich den frankophilen Herrn.
Es ist niemand anderer als der sechste (oder siebte, man ist sich bei der Zählung uneins) Baronet Sir Brooke Boothby, den ➱
Joseph Wright of Derby hier so elegant auf der Bühne des Waldes plaziert hatte. Ein Buch, auf dessen Rücken man
Rousseau lesen kann, in der Hand. Es ist nicht irgendein Wald, dies Waldstück hat eine besondere Bedeutung. Es heißt Twenty Oaks und ist in der Nähe von Wootton Hall. Wootton Hall gehört einem Richard Davenport, der das Haus selten bewohnt. Boothbys Landsitz Ashbourne Hall ist nicht weit davon. In Wootton Hall hatte der französische Philosoph 1766 vor seinen Feinden (oder seinen eingebildeten Feinden) Zuflucht gefunden, nachdem er sich zuvor mit seinem Gastgeber ➱
David Hume ➱
verkracht hatte. David Hume hat aber dafür gesorgt, dass Rousseau den Landsitz von Davenport nutzen dufte. Und hier in Twenty Oaks haben Rousseau und Boothby das
retournons à la nature zelebriert - obgleich sich dieser schöne Spruch der Rousseau zugeschrieben wird, bei ihm gar nicht finden lässt.
Wootton Hall ist inzwischen abgerissen, die Grotte im Park, wo Roussseau bekleidet mit seinem armenischen
Kaftan und seinem Pelzhut seine
Confessions geschrieben hat, ist noch da. Sie wird damals wohl ein Dach gehabt haben. Rousseau, der hier mit seiner Geliebten umsonst logiert, ist ein undankbarer Gast gewesen, nichts war ihm recht zu machen.
In spite of it all, I would rather live in the hole of the rabbits of this warren, than in the finest rooms in London. Ja, da spricht der echte Naturfreund. Rousseau scheidet im Unfrieden von seinen englischen Gastgebern,
to say the least. Am 16. Mai 1767 formuliert David Hume in einem Brief an Richard Davenport (der Rousseau beinahe nachsichtig als
wild philosopher bezeichnet hatte) den wunderbaren Satz:
In short, he is plainly mad, after having been long maddish. Und endet den Brief mit
The Lord have mercy on him! as you say. Brooke Boothby steht weiterhin zu Rousseau. Doch der wird ihm diese Freundschaft schlecht vergelten.
Ich versetze mal eben die kleine Penelope aus Reynolds Eichenwäldchen in das moderne Wohnzimmer. So sieht der Vorschlag aus, den eine chinesische Firma, die mit Reproduktionen handelt, ihren Kunden macht. Ist das nicht schrecklich? Das Waldstück, das Reynolds neben die kleine Penelope gemalt hat, sieht dem Twenty Oaks Waldstück bei Wright ziemlich ähnlich, wahrscheinlich hat Reynolds (oder sein Assistent, der für die Hintergründe zuständig war) den einfach als Vorlage genommen. Wenn man nur eine Woche Zeit hat, dann guckt sich ein Portraitmaler keinen echten Wald mehr an. Die Naturbegeisterung mag etwas für Rousseau oder Brooke Boothby sein, Reynolds interessiert sie nicht. Joseph Wright of Derby dagegen schon. Ich sollte vielleicht anfügen, dass Boothby sich nicht nur von Joseph Wright hat portraitieren lassen. Er hat noch andere Bilder bei ihm gekauft und hat ihn ständig protegiert.

Was die kleine Penelope Boothby auf dem Bild von Reynolds trägt, interessiert natürlich die Kostümhistoriker. So sagt ➱
Aileen Ribeiro (die führende Historikerin für diese Zeit):
over the white muslin frock of childhood, Penelope Boothby wears a matching white fichu crossed over the chest. The impression of the small girl borrowing the clothes of her mother or sister is given by the mob cap, a cap with puffed-out crown to accommodate the wide, rising hairstyles of the 1780s, but which looks overlarge on the flat, natural hair of the child.
Estelle May Hurll behauptete um 1900, dass die kleine Penelope sich als Martha Washington, wie sie auf dem ➱
Bild von Gilbert Stuart zu sehen sei, verkleidet hätte. Ist natürlich Quatsch: das Bild von Gilbert Stuart ist erst Jahre später gemalt. Dennoch ist an dem Gedanken etwas dran. Wenn wir dieses Martha Washington Bild von John Trumbull betrachten, dann haben ➱
mob cap und
Fichu auf den Bildern schon eine gewissen Ähnlichkeit. Es ist der Stil der Zeit, und die kleine Penelope - oder Joshua Reynolds - hat sich im Kleiderschrank von Mutter und Großmutter bedient. Ich weiß nicht, ob Dreijährige so gerne eine feine Dame spielen, man kann sicher aus Penelopes Gesichtszügen einen gewissen Unwillen gegen die vom Maler verordnete Rolle herauslesen.
Dieses Bild, das
Cherry Ripe heißt, ist nun ein klein wenig fies. Es wurde von John Everett Millais 1879 gemalt, die Vorlage ist ganz klar das Bild von Reynolds. Auf Umwegen. 1879 hatte die Kunstzeitschrift
The Graphic einen Kostümball veranstaltet, und die kleine Edie Ramage, die Nichte des Herausgebers
William Luson Thomas, hatte sich als Penelope Booth verkleidet. Die kleine Penelope von Joshua Reynolds hat jetzt plötzlich Konjunktur, sogar ➱
Lewis Carroll hat eine seiner vielen kleinen Freundinnen (
Alexandra [Xie] Kitchin) als Penelope Boothby verkleidet photographiert (unten).
Millais war so von dem Mädchen im Penelope Boothby Kostüm begeistert, dass er sie gleich nach dem Ball in sein Studio geschleppt hat, um sie zu malen. Das Bild hat ihren Onkel eintausend
guineas gekostet. Der Preis für kleine Mädchen in Öl ist seit 1788 offensichtlich gestiegen. Die Barbipuppe ist noch nicht erfunden. Die tausend
guineas waren trotzdem gut angelegt, weil Thomas das Bild in
The Graphic als Reproduktion zur Subskription anbot, wofür der den berühmtesten viktorianischen Kupferstecher
Samuel Cousins (der schon 1874 einen Stich von Reynolds' Bild herausgebracht hatte) angeheuert hatte. Mehr als eine halbe Million Engländer bestellten das Bild.
Dies hier ist eine Karikatur von dem unübertroffenen Max Beerbohm mit dem Titel
A Momentary Vision that Once Befell Young Millais. Da malt der junge Millais sein scheußliches Bild
Ferdinand lured by Ariel im Jahre 1849 und sieht sich plötzlich als alten Mann, der mit
Cherry Ripe Erfolg hat. Und was für einen, aus allen Teiles des Empire - und das ist damals die halbe Welt - schreiben Hunderttausende Dankesbriefe an Millais, weil er ihnen dieses schöne Mädchenbild geschenkt hat. Aus Kanada kommt sogar ein Gedicht als Weihnachtsgruß:
An humble Cannok on the shores
Of great Ontario's lake.
Who matchless 'Cherry Ripe' adores,
The liberty would take
To throw across the wintry sea
A warm and grateful cheer
To glorious Millais, and may he
Enjoy a good New Year !
Achtzig Jahre später wird Edie Ramage, die jetzt eine Mrs Francisco de Paula Ossorio ist, dem Präsidenten der Royal Academy erzählen, wie sie damals von John Everett Millais mit Schokolade bei den Sitzungen gefüttert worden ist. Da wusste man schon nicht mehr genau, wer damals das Modell gewesen war, weil sich inzwischen hunderte Frauen gemeldet hatten, die behaupteten, dass sie für
Cherry Ripe Modell gesessen hätten. Vielleicht haben sie da etwas verwechselt, vielleicht haben sie für ein anderes Bild gesessen: Millais hatte erkannt, dass mit kleinen Lolitas Geld zu machen ist. Das da an der Museumswand ist natürlich auch ein Millais.
Cherry Ripe ist im Juli 2004 für über zwei Millionen Dollar versteigert worden - für den Preis hätte man im gleichen Monat Brueghels
Winterlandschaft mit Vogelfalle kaufen können.
Die Amateurtheologin Pamela Tamarkin Reis hat in ihrem Aufsatz
Victorian Centerfold: Another Look at Millais' Cherry Ripe das Bild in die Nähe von Kinderpornographie gerückt. Warum hat das so lange gedauert? Bis 1992? Konnte man das nicht vorher schon so sehen? Schließlich das Bild von Millais ja auch gleich zu einem Werbeplakat von Pears Soap geworden, und deren Werbung bewegte sich ja beinahe immer an der Grenze. Ich habe darüber in dem Post ➱
Spätrömische Dekadenz schon einiges Böses gesagt, die Viktorianer sind mir ein wenig unheimlich. Der Katalog
The Victorian Nude versichert mir am Beispiel von Lewis Carrolls ➱
Schmuddelbildern allerdings:
pictures of naked girls were not marginal but mainstream.
Da bin ich aber froh. Das Bild hier konnte ich nicht auslassen, so sieht
Cherry Ripe heute aus. Ist natürlich
not marginal but mainstream. Wo die miese ➱
Verlagsbilanz von Bertelsmann gerade durch einen SM Porno namens
Fifty Shades of Grey vor dem Schlimmsten gerettet wurde. Man kann sich heute auch bei Amazon
Cherry Ripe (das Bild von Millais, nicht der Porno von Amarinda Jones) als Mousepad (
Natürliche Gummimatten bester Qualität) bestellen. Da kann man dann immer drauf rumfummeln. Aber den Grenzen des guten Geschmacks sind ja - wie bei der nach oben offenen Richter-Skala - nach oben hin keine Grenzen gesetzt.
Ich habe hier einen Text von einer Firma, die ebenso wie die chinesische Firma Reproduktionen von Gemälden anfertigt:
Das Ölgemälde Die Himmelfahrt der Penelope Boothby von Henry Fuseli wird von unseren professionellen Kunstmalern mit viel Liebe und Nähe zum Detail angefertigt. Die Kunstkopie wird in der höchsten Qualitätsstufe gemalt. Die Wirkung und Wertigkeit des handgemalten Ölgemäldes wird Ihren [sic] Wohnraum einen Hauch von Galeriefeeling verleihen und Sie über eine sehr lange Zeit erfreuen.
Ja, wenn Sie ein
Galeriefeeling in Ihrem Wohnraum haben wollen, dann hängen Sie sich unbedingt
The Apotheosis of Penelope Boothby von ➱
Füssli ins Wohnzimmer. Die kleine Penelope ist nicht sehr alt geworden, sie ist 1791 nach dreiwöchiger Krankheit gestorben. Für den Vater, der seine Tochter nach Rousseaus pädagogischen Lehren erzogen hatte, der Beginn von lebenslanger Trauer.
Und einem erstaunlichen Totenkult. Er bestellt bei
Thomas Banks ein ➱
Grabmal aus weißen Carrara Marmor, das an das Grabmal erinnert, das ➱
Nollekens für die Frau von Henry Howard geschaffen hat. Der mit ihm befreundete Henry Fuseli (dem er schon den ➱
Nachtmahr abgekauft hatte) malt dann diese
Apotheosis of Penelope Boothby (oben), die jedem Wohnzimmer ein Galeriefeeling verleiht. Er illustriert auch den schmalen Gedichtband ihres Vaters, der
Sorrows: Sacred to the Memory of Penelope heißt. Ich zitiere daraus einmal das fünfte Sonett:
Death! Thy cold hand the brightest flower has chill'd,
That e'er suffused love's cheek with rosy dies;
Quench'd the soft radiance of the loveliest eyes,
And accents tuned to sweetest music still'd;
The springing buds of hope and pleasure kill'd;
Joy's cheerful measures changed to doleful sighs;
Of fairest form, and fairest mind the ties
For ever rent in twain-- So Heaven has will'd!
Though in the bloom of health, thy arrow fled,
Sudden as sure; long had prophetic dread
Hung o'er my heart, and all my thoughts depress'd.
Oft when in flowery wreaths I saw her dress'd,
A beauteous victim seemed to meet my eyes,
To early fate a destined sacrifice.
Ein englischer Landedelmann, der Rousseau verehrt und seine Tochter nach den pädagogischen Zielen des Freundes aufzieht. Und der einen beispiellosen Totenkult betreibt, den erst das viktorianische Zeitalter übertreffen wird. Und auf der anderen Seite der Franzose mit dem Verfolgungswahn, der Mann, der
Émile ou De l'éducation geschrieben hat. Der lässt seine Kinder nicht von einem berühmten Maler malen, der gibt sie im Waisenhaus ab.
Ja, Madame, ich habe meine Kinder ins Findelhaus gethan. Ich habe ihre Erziehung der für diesen Zweck errichteten Anstalt übertragen. Wenn mein Elend und meine Leiden mir die Befähigung entziehen, einer so schönen Sorge obzuliegen, so ist das ein Unglück, wofür man mich beklagen muß, und nicht ein mir vorzuwerfendes Verbrechen. Ich bin ihnen die Subsistenz schuldig; ich habe ihnen eine bessere oder wenigstens eine sichrere verschafft, als die, welche ich selbst hätte geben können. Dieser Artikel geht Allem vor. Dann kommt die Rücksicht auf ihre Mutter, die nicht entehrt werden darf.

Sie, Madame, kennen meine Lage; ich verdiene mein Brod von einem Tag zum andern mühevoll genug. Wie würde ich noch eine Familie ernähren? Und wenn ich gezwungen würde, zum Schriftstellermetier zu greifen, wie könnte ich über den häuslichen Sorgen und dem Lärm der Kinder in meiner Spelunke die Ruhe des Geistes bewahren, welche zu einer gewinnbringenden Arbeit erforderlich ist? Die Schriften, welche der Hunger diktirt, tragen nicht viel ein, und diese Hülfsquelle ist bald erschöpft. Also müßte ich zu den Protektionen meine Zuflucht nehmen, zur Intrigue, zur Verstellung; ich müßte mich um irgend ein niedriges Amt bewerben, es ausbeuten durch die gewöhnlichen Mittel, denn sonst würde es mich nicht ernähren und mir bald entzogen werden; kurz, ich müßte mich allen Infamien hingeben, gegen die ich von einem so gerechten Abscheu durchdrungen bin. Mich, meine Kinder und ihre Mutter von dem Blute der Unglücklichen nähren! Nein, Madame, es ist besser, sie sind Waisen, als wenn sie einen Schurken zum Vater hätten.