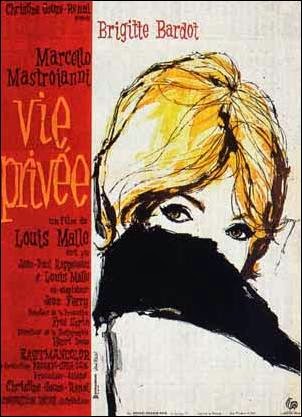Die Zifferblätter von Uhren können mit der Zeit altern, dunkler werden.
Rolex Händler sprechen bei ganz dunklen Zifferblättern gerne von
→Tropical, obgleich die Uhr niemals in den Tropen war. Der allgemein gebräuchliche Terminus für die Verfärbung ist
→Patina. Wenn die vollständig gleichmäßig wäre, würde das niemanden stören, aber meistens sieht das eher so ähnlich aus wie auf disem Photo. Man sollte nicht versuchen, mit sogenannten Zifferblattbürsten und irgendwelchen Flüssigkeiten dem Ganzen beizukommen. Mein
Uhrmacher, der alles konte, hat mir mal den ganzen braunen Firnis vom Zifferblatt einer alten
Eterna abgezogen. Sah danach wie neu aus, nur der Schriftzug
Eterna hat bei der Methode etwas gelitten. Wenn man ein schönes neues Zifferblatt haben will, dann sollte man sich an Spezialisten wie
Bethge oder
Causemann wenden. Die sind seit mehr als einem halben Jahrhundert im Geschäft, die können so etwas. Der Zifferblatthersteller
Cador kann das auch. Der Händler, der diesen King Seiko Chronometer anbot, sagte nicht, dass die Uhr ein völlig versifftes Zifferblatt hätte. Er sagte, dass dies ein seltenes
Wabi-Sabi Zifferblatt sei, das die Uhr noch wertvoller machte.
Dieses Wabi-Sabi ist ein japanisches ästhetisches Konzept, das die Schönheit in unvollkommenen Dingen sucht, eine Ästhetik des Unperfekten. Wenn man zum Zen Buddhismus neigt, wird einem Wabi-Sabi vertraut sein. Vom Zen Buddhismus verstehe ich nicht so viel, obgleich ich
Zen and the Art of Motorcycle Maintenance (hier im Volltext) gelesen habe. Man kann Wabi-Sabi als einen Gegenentwurf zu der westlichen
→Ästhetik des Schönen sehen, an der sich seit Plato die Philosophen abgearbeitet haben. Allerdings ist die japanische Lehre inzwischen schon ein wenig kommerzialisiert. Und damit meine ich nicht den Uhrenhändler, der ein versifftes Zifferblatt als edles Wabi-Sabi verkaufen will. Nein, die
Vogue gebraucht den Begriff neuerdings häufig und hat schon eine Seite
Make-up-Trend: Das japanische Wabi-Sabi zelebriert das Imperfekte.
Um auf die Zifferblätter zurückzukommen: ich lasse sie bei meinen Uhren eigentlich wie sie sind. Ich habe mir einmal von Bethge ein neues Zifferblatt für eine Certina aus den vierziger Jahren machen lassen, das ist sehr gut geworden. Ich kämpfe seit Jahren mit mir, ob ich meine Enicar Sherpa 300 zu Bethge schicken soll. Aber dann finde ich die Patina, die das Zifferblatt bei jedem Lichteinfall anders aussehen läßt, doch sehr interessant. Und die Indices mit den kleinen imitierten Brillis des Seapearl Modells leuchten so schön. Ich genieße das jetzt als Wabi-Sabi.

Im letzten Jahr boten mir meine →
Lieblingshändler diese Grand Seiko Quartz zum Kauf an. Sie war von einem Fachmann in Dänemark in ihrem elektronischen Inneren voll überholt worden, hatte aber als Schönheitsfehler ein gleichmäßig helles c
afé au lait Zifferblatt. Das Photo hier täuscht ein wenig, die Farbe ist wirklich gleichmäßig. Ich kaufte die Uhr, weil sie ein originales Stahlarmband (signiert in der Schließe mit GQ) hatte. Das ist bei einer alten Grand Seiko Quartz relativ selten. Und die Zifferblattfarbe finde ich sehr schön. Und vornehm. Eben ein bisschen Wabi-Sabi.







%20into%20Antwerp%20in%201520%201878%20%20(see%20also%20141421%20141423%20and%20141424)%20-%20(MeisterDrucke-114696).jpg)




















.png)