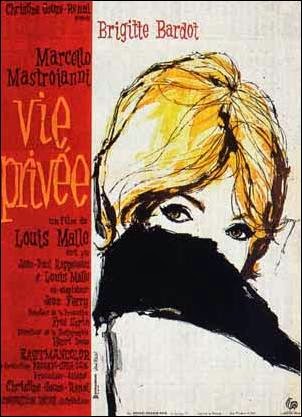ES begab ſich aber zu der zeit / Das ein Gebot von dem Keiſer Auguſto ausgieng / Das alle Welt geſchetzt würde. Vnd dieſe Schatzung war die allererſte / vnd geſchach zur zeit / da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Vnd jederman gieng / das er ſich ſchetzen lieſſe / ein jglicher in ſeine Stad.
DA machet ſich auff auch Joſeph / aus Galilea / aus der ſtad Nazareth / in das Jüdiſcheland / zur ſtad Dauid / die da heiſſt Bethlehem / Darumb das er von dem Hauſe vnd geſchlechte Dauid war / Auff das er ſich ſchetzen lieſſe mit Maria ſeinem vertraweten Weibe / die war ſchwanger. Vnd als ſie daſelbſt waren / kam die zeit / das ſie geberen ſolte. Vnd ſie gebar jren erſten Son / vnd wickelt jn in Windeln / vnd leget jn in eine Krippen / Denn ſie hatten ſonſt keinen raum in der Herberge.
VND es waren Hirten in der ſelbigen gegend auff dem felde / bey den Hürten / die hüteten des nachts jrer Herde. Vnd ſihe / des HERRN Engel trat zu jnen / vnd die Klarheit des HERRN leuchtet vmb ſie / Vnd ſie furchten ſich ſeer. Vnd der Engel ſprach zu jnen. Fürchtet euch nicht / Sihe / Ich verkündige euch groſſe Freude / die allem Volck widerfaren wird / Denn Euch iſt heute der Heiland gebörn / welcher iſt Chriſtus der HErr / in der ſtad Dauid. Vnd das habt zum Zeichen / Ir werdet finden das Kind in windeln gewickelt / vnd in einer Krippen ligen. Vnd als bald ward da bey dem Engel die menge der himeliſchen Herrſcharen / die lobten Gott / vnd ſprachen / Ehre ſey Gott in der Höhe / Vnd Friede auff Erden / Vnd den Menſchen ein wolgefallen.
VND da die Engel von jnen gen Himel furen / ſprachen die Hirten vnternander / Laſſt vns nu gehen gen Bethlehem / vnd die Geſchicht ſehen / die da geſchehen iſt / die vns der HERR kund gethan hat. Vnd ſie kamen eilend / vnd funden beide Mariam vnd Joſeph / dazu das Kind in der krippen ligen. Da ſie es aber geſehen hatten / breiteten ſie das wort aus / welchs zu jnen von dieſem Kind geſagt war. Vnd alle / fur die es kam / wunderten ſich der Rede / die jnen die Hirten geſagt hatten. Maria aber behielt alle dieſe wort / vnd beweget ſie in jrem hertzen. Vnd die Hirten kereten widerumb / preiſeten vnd lobten Gott vmb alles / das ſie gehöret vnd geſehen hatten / wie denn zu jnen geſagt war.
Wir, liebe Leser, feiern heute zum fünfzehnten Mal Weihnachten zusammen. Heute gibt es die Weihnachtsgeschichte in der Version Luthers. 2010 stand hier der Engländer William Tyndale, der die Bibel hundert Jahre vor der Kings James Version ins Englische übersetzt hatte.
Als ich klein war, wusste ich nicht, was ein Landpfleger ist. Aber wenn in der Weihnachtspredigt nicht
Kyrenius Landpfleger in Syrien war vorkam, dann wäre es kein Weihnachten gewesen. Wenn man einen Text nicht gleich versteht, weil er nicht in der Form eines
easy readers daherkommt, dann erwächst der Wunsch, ihn verstehen zu wollen. Das
Was ist das? Was ist das? bleibt die große Frage - auch wenn ihr nicht
Je, den Düwel ook, c’est la question, ma tres chère demoiselle! nachgesetzt wird wie in Thomas Manns
Buddenbrooks. Und deshalb gibt es heute, weil es so schön klingt, die Weihnachtsgeschichte in der Übersetzung von William Tyndale:
It followed in those days: that there went out a commandment from August the Emperor, that all the world should be valued. This taxing was first executed when Syrenus was leftenant in Syria. And every man went into his own shire town, there to be taxed. And Ioseph also ascended from Galilee, out of a city called Nazareth, into jewry: into the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David to be taxed with Mary his wedded wife, which was with child. And it fortuned while they were there, her time was come that she should be delivered. And she brought forth her first begotten son. And wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them within, in the ynne. And there were in the same region shepherds abiding in the field, and watching their flock by night. And lo: the angel of the Lord stood hard by them, and the brightness of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them: Be not afraid: Behold I bring you tidings of great joy, that shall come to all the people: for unto you is born this day in the city of David a saviour, which is Christ the Lord. And take this for a sign: ye shall find the child swaddled, and laid in a manger. And straight way there was with the angel a multitude of heavenly soldiers, lauding God, and saying: Glory to God on high, and peace on the earth: and unto men rejoicing. And it fortuned, as soon as the angels were gone away into heaven, the shepherds said one to another: let us go even unto Bethlehem, and see this thing that is happened, which the Lord hath shewed unto us. And they came with haste, and found Mary and Ioseph, and the babe laid in a manger. And when they had seen it, they published abroad the saying, which was told them of that child. And all that heard it wondered, at those things which were told them of the shepherds. But Mary kept all those sayings, and pondered them in her heart. And the shepherds returned, praising and lauding God for all that they had heard and seen, even as it was told unto them.
Ich wünsche meinen Lesern ein schönes Weihnachtsfest.


















.png)