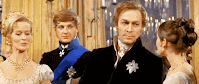Die Herzogin von Richmond ist mit ihrem Mann im Jahre 1814 nach Brüssel gekommen. Ihr Mann wäre lieber zuhause geblieben und hätte Cricket gespielt. Dafür war er berühmt, er gehört auch zu den Gründungsmitgliedern des Marylebone Cricket Clubs. Aber zu seiner Lieblingsbeschäftigung kommt Charles Lennox nicht, es ist Krieg in Europa. Und er ist General der englischen Armee, kommandiert ein Reservekorps, das die belgische Hauptstadt sichern soll. Lennox ist mit seiner Gattin in Brüssel, weil er es sich finanziell nicht leisten kann, in England zu wohnen. Er hat mit dem Titel eines Herzogs auch Schulden in der Höhe von 180.000 Pfund Sterling geerbt (das wären heute einige Millionen Pfund).
Aber trotz der finanziellen Engpässe gibt seine Gattin (hier von Thomas Lawrence gemalt) am 15. Juni 1815, einem Donnerstag wie heute, einen Ball. Es wird der berühmteste Ball der Geschichte. Sie hatte den Duke of Wellington gefragt, ob sie diesen Ball abhalten könne: Duke, I do not wish to pry into your secrets, nor do I ask what your intentions may be: I wish to give a ball and all I ask is – may I give a ball? If you say ‘Duchess, don’t give your ball’ it is quite sufficient. I ask no reasons. Wellington sagt ihr: Duchess, you may give your ball with the greatest safety, without fear of interruption. Sie wissen alle nicht, wo Napoleon gerade ist, Wellington glaubt, Boney sei in Paris. In Wirklichkeit ist der Korse schon vor Charleroi, fünfzig Kilometer vor Brüssel.
Über zweihundert Gäste sind da, mehr Männer als Frauen. Prinzen und Herzöge en masse. Vielleicht war der Londoner Dandy Rees Howell Gronow (ein Freund von Shelley) auch auf dem Ball, auf den Schlachtfeldern von Quatre Bras und Waterloo ist er in den nächsten beiden Tagen auf jeden Fall. Beinahe alle Herren tragen Uniform. Der Herzog von Wellington kommt kurz vor Mitternacht, er wird nicht viel Zeit zum Tanzen haben. Der Herzog von Richmond hatte seinen Töchtern das Walzertanzen verbieten wollen, aber jetzt werden Walzer getanzt. That gentleman will spoil the dancing, sagt die Herzogin zu ihrem Tanzparner Wellington, und sie meint Napoleon. Sie hat das nicht wirklich gesagt, das sagt nur Virginia McKenna zu Christopher Plummer in Sergei Bondartschuks Film ✺Waterloo.
Um ein Uhr morgens wird ein Essen serviert, Wellington hat gerade einen Brief mit einer wichtigen Botschaft bekommen. Aber er öffnet den Brief nicht, er weiß, was darin steht. Er bleibt am Tisch sitzen und macht Konversation mit seinen Nachbarn und der Herzogin. Dann steht er auf, entschuldigt sich bei den Gästen und flüstert seinem Freund dem Herzog von Richmond zu: Hast Du eine gute Karte von der Gegend? Der Herzog hat. In einem Nebenraum studieren sie die Karte. Sie wissen jetzt, wo Napoleon ist. Er hat mich wieder reingelegt, sagt Wellington. Wir werden ihn in Quatre Bras nicht aufhalten können. Ich will die Schlacht hier. Und er zeigt mit dem Finger auf Waterloo. Wellington ist da schon einmal gewesen, er hat sich die Gegend gut angeschaut. Die höheren Offiziere sind schon leise und unauffällig aus dem Saal verschwunden, aber der Ball geht immer noch weiter. Die jüngeren Offiziere tanzen ein letztes Mal mit ihren Angebeteten. Für viele ist es der letzte Tanz ihres Lebens. Sie werden morgen in Quatre Bras kämpfen. Und übermorgen in Waterloo.
Der Ball der Herzogin von Richmond ist auch in die Literatur gewandert. In Thackerays Roman Vanity Fair heißt es: There never was, since the days of Darius, such a brilliant train of camp-followers as hung round the Duke of Wellington's army in the Low Countries, in 1815; and led it dancing and feasting, as it were, up to the very brink of battle. A certain ball which a noble Duchess gave at Brussels on the 15th of June in the above-named year is historical. All Brussels had been in a state of excitement about it, and I have heard from ladies who were in that town at the period, that the talk and interest of persons of their own sex regarding the ball was much greater even than in respect of the enemy in their front. The struggles, intrigues, and prayers to get tickets were such as only English ladies will employ, in order to gain admission to the society of the great of their own nation. Die etwas amoralische Heldin Becky Sharp sagt, dass sie auch auf dem Ball gewesen ist. Und der Ball ist dann auch in dem amerikanischen Film ✺Becky Sharp (1935) zu sehen, dem ersten abendfüllenden Technicolor Film. Gehen Sie einmal zur Minute 37:00, dann folgen die choreographisch aufregendsten vier Minuten des Films, alles ist in Bewegung.
Lord Byron, der Napoleon bewunderte, hat den Ball in seinem Gedicht Childe Harold's Pilgrimage erwähnt:
And Belgium’s capital had gathered then
Her beauty and her chivalry, and bright
The lamps shone o’er fair women and brave men.
A thousand hearts beat happily; and when
Music arose with its voluptuous swell,
Soft eyes looked love to eyes which spake again,
And all went merry as a marriage bell;
But hush! hark! a deep sound strikes like a rising knell.
Did ye not hear it?—No; ’twas but the wind,
Or the car rattling o’er the stony street:
On with the dance! let joy be unconfined;
No sleep till morn, when youth and pleasure meet
To chase the glowing hours with flying feet—
But, hark!—that heavy sound breaks in once more,
As if the clouds its echo would repeat
And nearer, clearer, deadlier than before!
Arm! arm! it is—it is the cannon’s opening roar.
Ah! then and there was hurrying to and fro,
And gathering tears, and tremblings of distress,
And cheeks all pale, which but an hour ago
Blush’d at the praise of their own loveliness;
And there were sudden partings, such as press
The life from out young hearts, and choking sighs
Which ne’er might be repeated: who could guess
If ever more should meet those mutual eyes,
Since upon night so sweet such awful morn could rise!
And there was mounting in hot haste: the steed,
The mustering squadron, and the clattering car
Went pouring forward with impetuous speed,
And swiftly forming in the ranks of war;
And the deep thunder, peal on peal afar;
And near, the beat of the alarming drum
Roused up the soldier ere the morning star;
While thronged the citizens with terror dumb,
Or whispering with white lips, “The foe! they come! they come!”
Last noon beheld them full of lusty life,
Last eve in Beauty’s circle proudly gay,
The midnight brought the signal sound of strife,
The morn the marshaling in arms,—the day
Battle’s magnificently stern array!
The thunder clouds close o’er it, which when rent
The earth is covered thick with other clay,
Which her own clay shall cover, heaped and pent,
Rider and horse—friend, foe—in one red burial blent.
In Sigrid Combüchens Roman Byron gibt es eine Szene, in der einige Byron Verehrer mit Hilfe der Tischplatte, einer Spalte darin sowie zwei Brieftaschen, einigen Gläsern, einer Flasche, die hin und her gerollt wurde, und einer Hand, die sich ab und zu um Gläser und Brieftaschen schloß, die Schlacht von Waterloo nachstellten. Allerdings trägt der Duke of Wellington bei ihr eine rote Uniform, was historisch falsch ist, er trägt in der Schlacht von Waterloo eine dunkelblaue Uniform. Was man hier auf diesem kleinen Schnipsel aus Bondartschuks Film ✺Waterloo sehen kann. Ab Minute 34:00 sind Sie mitten im Trubel des Balles. Wenn da die Gordon Highlanders einen Schwertertanz aufführen, dann ist das historisch korrekt, die waren wirklich als Attraktion für die Gäste auf dem Ball. I well remember the Gordon Highlanders dancing reels at the ball. My mother thought it would interest foreigners to see them, which it did. I remember hearing that some of the poor men who danced in our house died at Waterloo. There was quite a crowd to look at the Scotch dancers, schreibt Lady Louisa Lennox, die Tochter der Herzogin. Sie wird das ganze Jahrhundert durchleben und erst im Jahre 1900 sterben.
Historienfilme verändern immer die Wirklichkeit, der Film Becky Sharp hat mit der Wirklichkeit der Nacht von Brüssel und den Tagen von Quatre Bras, Ligny und Waterloo nichts zu tun. Wir können Sergei Bondartschuk schon dankbar sein, dass er uns in Filmen wie Krieg und Frieden und Waterloo ein klein wenig von der Zeit wiedergegeben hat. Der Thackeray des 21. Jahrhunderts heißt Julian Fellowes, er ist jetzt ein Baron Fellowes, um genau zu sein. Er hat einen Roman geschrieben, der mit dem Ball der Herzogin von Richmond beginnt. Und der musste natürlich verfilmt werden, historisch genau, wie es sich für eine Literaturverfilmung und einen Kostümfilm gehört (lesen Sie hier mehr dazu). Hier sehen wir den Herzog von Wellington bei Quatre Bras. Er trägt eine blaue Uniform, wahrscheinlich dieselbe, die er am Abend zuvor bei der Herzogin von Richmond getragen hat. Der blaue Reitmantel, den er hier trägt, ist übrigens für 47.500 £ vom National Army Museum in London ersteigert worden.
In dem Genre Kostümfilme kennt sich Fellowes aus, er hat die Drehbücher für Gosford Park und Downtown Abbey geschrieben. Die neue TV Serie heißt wie sein Roman Belgravia, sie ist bunt und plüschig. Und Nicholas Rowe trägt als Herzog von Wellington eine rote Uniform beim Ball der Richmonds. Es ist eine Phantasieuniform, man hätte sich besser an dem Portrait von Thomas Lawrence orientieren sollen. Sie können, wenn Sie wollen, hier den ersten ✺Teil der Serie sehen.
Die Rezensionen waren sehr gemischt, der Rezensent des Guardian beendete seine Besprechung mit den Sätzen: So: something to pass the time as the coronavirus curfew descends, or something to send you screaming into the streets and licking the first handrail you can find? The decision is yours. The agents, at least, are happy either way. Aber woher soll es kommen? Der Roman Belgravia ist eine schlecht geschriebene Schmonzette (unter dem Pseudonym Rebecca Greville hatte Fellowes in den siebziger Jahren schon Schundromane verfasst), die vorgibt, ein Gesellschaftsroman zu sein. Tolstoi und Fontane schreiben Gesellschaftsromane, der Lord Fellowes nicht.




.jpg)